Das Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein (LAGSH) in Kiel hat mit seinem Urteil (Az. 5 Sa 284 a/24) zur Entgeldfortzahlung bei Tattoo-Komplikationen eine Debatte ausgelöst, die weit über den konkreten Fall vor dem Arbeitsgericht Flensburg (Az. 1 Ca 278/24) hinausreicht.
Konkret entschied und bestätigte das LAGSH nun in zweiter Instanz des AG-Flensburg: Wer durch eine Tätowierung arbeitsunfähig wird, hat keinen Anspruch auf Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall.
Das Stechen einer Tätowierung sei ein „eigenwirtschaftliches Risiko“, vergleichbar mit risikobehafteten Freizeitaktivitäten. Dieses Urteil wirft grundlegende Fragen zum Verhältnis von persönlicher Lebensgestaltung, Krankheitsrisiken und arbeitsrechtlichem Schutz auf.
Legal Tribute Online (LTO) hat als Beispiel darüber kürzlich berichtet:
LAG Schleswig-Holstein: Krank wegen Tattoo, Arbeitgeber muss nicht zahlen
tw/LTO-Redaktion
Das Urteil im Volltext der 5. Kammer des Landesarbeitsgerichts Schleswig-Holstein ist nun online hier zu finden >>
Die Begründung der Gerichte und was uns daran irritiert
Das Gericht oder besser beide Gerichte argumentieren, dass das Tätowieren eine freiwillige Handlung sei. Sie ist weder medizinisch noch berufsbedingt notwendig!
„Die Klägerin hätte damit rechnen können, dass sich ihr Tattoo entzündet, da sich auf fünf Prozent der Fälle nicht auf eine völlig fernliegende Komplikation schließen lasse„, so das LAG.
Wer sich also aus rein privaten Gründen tätowieren lasse und dabei eine Entzündung oder andere Komplikation erleide, könne nicht verlangen, dass der Arbeitgeber das Lohnrisiko trägt, wenn man sich daraufhin nicht zur Arbeit schleppen könne.
Ähnlich denken ja mittlerweile auch manche Krankenkassen und verlangen bei Tattoo-Komplikationen bis hin zu einer medizinisch notwendigen Entfernung oft und gerne mindestens eine prozentuale Euro-Beteiligung der Betroffenen.
Das Motto dazu lautet: „Was kann Dein Nachbar dafür, dass Du gesundheitliche Probleme mit Deiner Tätowierung hast und warum sollte er dafür bezahlen?„
Diese Logik wirkt auf den ersten Blick und auch für uns total nachvollziehbar. Schließlich gibt es auch bei anderen Freizeitaktivitäten Risiken. Wer sich absichtlich einem Risiko aussetzt, soll dafür doch gerne selbst die Verantwortung übernehmen.
Doch genau hier beginnt aus unserer Sicht die Problematik ABER auch ein reizvoller Argumentationsweg, wenn es um die Berufszugangsregulierung für die Tattoo-Branche geht.
Denn die Einordnung als „eigenwirtschaftliches Risiko“ erfolgt selektiv. Andere freiwillige Aktivitäten, die ebenso oder sogar deutlich riskanter sind, ziehen oftmals keine Einschränkungen bei der Lohn- oder Entgeldfortzahlung nach sich.
Wer sich beim Skifahren, beim Fußball oder beim Heimwerken verletzt, erhält ganz selbstverständlich weiterhin sein Gehalt. Auch wenn es sich dabei um vermeidbare Risiken handelt. Wieso also soll ausgerechnet das professionelle Tätowieren anders behandelt werden? Weil es lt. der Gerichte bei Tätowierungen in 1% bis 5 % der Fälle zu Komplikationen in Form von Entzündungsreaktionen der Haut kommen kann?
Klugscheißer Fun-Fact: Studien aus Europa und den USA geben an, dass sogar 5 bis 10 % der Tätowierten innerhalb der ersten Wochen nach dem Stechen entzündliche Reaktionen erleben können. Den Wert 1% – 5% bezieht die Fachwelt hingegen auf Infektionen und findet man im Wiley online Library Universum.
Dazu darf man sich jetzt gerne mal den Text des § 3 des Gesetzes über die Zahlung des Arbeitsentgelts an Feiertagen und im Krankheitsfall (Entgeltfortzahlungsgesetz, kurz: EntgFG) und den „Anspruch auf Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall“ im Zitat durchlesen:
„(1) Wird ein Arbeitnehmer durch Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit an seiner Arbeitsleistung verhindert, ohne daß ihn ein Verschulden trifft, so hat er Anspruch auf Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall durch den Arbeitgeber für die Zeit der Arbeitsunfähigkeit bis zur Dauer von sechs Wochen. Wird der Arbeitnehmer infolge derselben Krankheit erneut arbeitsunfähig, so verliert er wegen der erneuten Arbeitsunfähigkeit den Anspruch nach Satz 1 für einen weiteren Zeitraum von höchstens sechs Wochen nicht, wenn
- er vor der erneuten Arbeitsunfähigkeit mindestens sechs Monate nicht infolge derselben Krankheit arbeitsunfähig war oder
- seit Beginn der ersten Arbeitsunfähigkeit infolge derselben Krankheit eine Frist von zwölf Monaten abgelaufen ist.(…)“
Unsere Fragen: Wer hat Schuld an einer Tattoo-Entzündung, wenn nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt wurde? Das Huhn oder das Ei? Und wer haftet eigentlich?
Die gesellschaftliche Realität wird unserer Ansicht nach ignoriert
Tätowierungen sind nun längst kein spektakuläres Randphänomen mehr. Nach Umfragen sind rund 25 bis 30 Prozent der Erwachsenen alleine in Deutschland tätowiert. In bestimmten Altersgruppen und Ländern liegt der Anteil sogar noch deutlich höher und unsere Welt wird in absehbarer Zukunft nicht weniger bunt.
Tattoos gehören heute also zum Alltag, sind Ausdruck von Individualität, kultureller Zugehörigkeit oder schlicht ästhetischer Vorlieben. Im Bereich Medical Tattooing sogar medizinisch anerkannt.
Aber was ist jetzt so reizvoll an der Denke zu den Urteilen der Gerichte in Schleswig-Holstein?
Sie ignorieren diese gesellschaftliche Realität einfach und behandeln das Tätowieren rechtlich wie eine exotische Hochrisiko-Aktivität.
Damit wird aus unserer Sicht aber ein Lebensstilpfad kriminalisiert, der längst normal geworden ist. Jedenfalls, wenn er professionell ausgeführt wird!
Tätowieren, reguliert oder nicht?
Das Problem liegt in der Bewertung des Tätowierens als „unreguliertes Privatvergnügen“. Juristisch betrachtet ist das aktuell sicherlich auch nach unserem Hobby-Jura-Bauchgefühl korrekt, denn der Beruf des Tätowierers ist in Deutschland nicht staatlich reglementiert.
Es gibt keine verpflichtende Ausbildung, keine Zulassungspflicht und hat keine Berufsaufsicht.
Gleichzeitig greift der Staat aber sehr wohl regulierend in dieses „Privatvergnügen“ ein. Allerdings nicht bei der Berufsausübung, sondern bei den eingesetzten Materialien und teilweise bei den Hygienestandards.
Über die europäische Chemikalienverordnung REACH wird exakt geregelt, welche Farben und Inhaltsstoffe verwendet werden dürfen. Übrigens härter reglementiert als Trinkwasser.
Zusätzlich existiert die europäische Norm DIN EN 17169, die Hygieneanforderungen für Tattoo-Studios beschreibt, wenn auch auf freiwilliger Basis, nebst den länderspezifischen Hygiene- und zusätzlichen Tätowiermittelverordnungen (TätoV).
Hier zeigt sich für uns ein Systemwiderspruch. Auf der einen Seite erkennt der Staat Tätowieren als Teil der Dienstleistungswirtschaft an und reguliert fröhlich und anscheinend nach Laune die Rahmenbedingungen für Anwender und Verbraucher.
Auf der anderen Seite betrachten die Gerichte die Inanspruchnahme dieser Dienstleistung als privat verschuldetes Risiko.
Gefahr eines problematischen Präzedenzfalls (privat & beruflich)
Noch gravierender ist – vor allen Dingen, wenn man sich die aktuellen News-Headlines on- und offline ansieht und selbst das Deutsche Ärzteblatt darüber schreibt -, dass dieses Urteil einen gefährlichen Präzedenzfall schaffen könnte.
Denn wenn Tattoo-Komplikationen von der Lohnfortzahlung ausgeschlossen sind, wo zieht man dann die Grenze?
Was ist mit Piercings, Schönheitsoperationen, Permanent Make-up oder kosmetischen Zahnbehandlungen, Botox, Filler, Laser? All diese Eingriffe sind medizinisch nicht notwendig, können aber natürlich medizinische Komplikationen nach sich ziehen.
Noch weiter gedacht, müssen Arbeitnehmer demnächst offenlegen, ob sie privat Extremsport betreiben, Marathon laufen oder sich ein Tattoo stechen lassen wollen?
Sind Reisen in tropische Länder mit Gesundheitsrisiken künftig auch ein Fall für die Lohnfortzahlung oder nicht? Die Logik des Urteils und seiner Bestätigung lässt uns solche Fragen zu und sie scheinen aus unserer Sicht nicht trivial.
Da unser privates Jura-Bauchgefühl hierfür allerdings nicht ausreicht, um uns eine adäquate Antwort zu liefern, haben wir neben Juristen auch mal ChatGPT gefragt.
Lustig ist dabei, dass die beiden Juristen den Urteilen primär zustimmen und die KI eher unserer Denke nach argumentiert. Und das liegt nicht an unserer Formulierung des Prompts!
ChatGPT schreibt uns: Das Grundproblem der selektiven Risikobewertung
Am Kern des Problems steht eine selektive Bewertung von Risiken. Tätowieren wird als vermeidbar und daher als „selbstverschuldet“ bewertet. Gleichzeitig wird aber gesellschaftlich akzeptiert, dass Menschen sich Freizeitrisiken aussetzen und das vollkommen ohne arbeitsrechtliche Konsequenzen.
Das Arbeitsrecht kennt keine generelle Pflicht zur Risikovermeidung im Privatleben. Es schützt den Arbeitnehmer auch dann, wenn er sich bewusst Risiken aussetzt, solange diese nicht grob fahrlässig oder vorsätzlich herbeigeführt werden. Eine Tätowierung erfüllt diesen Tatbestand keineswegs.
Verfassungsrechtliche Bedenken nicht ausgeschlossen
Nicht zuletzt stellt sich die Frage, ob dieses Urteil dem Gleichheitsgrundsatz nach Artikel 3 des Grundgesetzes standhält. Die Ungleichbehandlung von Tätowierten gegenüber anderen Arbeitnehmern, die aus privaten Gründen krankheitsbedingt ausfallen, ist offensichtlich. Ob das Urteil in einer verfassungsrechtlichen Überprüfung Bestand hätte, ist fraglich.
Fazit: Mehr Diskussion, weniger Stigmatisierung
Das Urteil vom AG-Flensburg nebst Bestätigung durch das LAG Schleswig-Holstein werfen mehr Fragen auf, als sie beantworten.
Es bleibt zu hoffen, dass diese Entscheidung kein Maßstab für die Zukunft wird. Denn sie blendet sowohl die gesellschaftliche Normalität von Tätowierungen als auch die tatsächlichen Risikoverhältnisse aus.
Statt selektiver Stigmatisierung braucht es eine ehrliche Diskussion darüber, wie wir als Gesellschaft mit Lebensrisiken umgehen. Und ob wir es wirklich wollen, dass Gerichte bestimmen, welche Formen von Körpergestaltung/ Körperverletzung akzeptabel sind und welche nicht. (Zitat)
Apropos Körperverletzung nach § 228 StGB beim Tätowieren
Das Stechen einer Tätowierung erfüllt ja bekannter Maßen formal den Tatbestand der vorsätzlichen Körperverletzung nach § 223 StGB. Weil die Haut als Schutzbarriere durchstochen und Farbe mit Nadeln & Co. eingebracht wird.
Dass dies für Tattoo-Artists in Deutschland nicht strafbar ist, liegt daran, dass der Kunde eine wirksame schriftliche Einwilligung erteilt und genau das regelt § 228 StGB.
§ 228 StGB schützt allerdings nur, wenn die Körperverletzung nicht gegen die guten Sitten verstößt. Tätowieren ist gesellschaftlich anerkannt und daher auf diese Art selbstverständlich nicht (mehr) sittenwidrig.
Wer tätowiert, übernimmt auch eine gewisse Sorgfaltspflicht, insbesondere hinsichtlich Hygiene und Aufklärung.
Juristisch gesehen ist die Einwilligung also eine Voraussetzung für die straflose Durchführung, hat aber keine unmittelbare „arbeitsrechtliche“ Wirkung auf Fragen wie Entgeltfortzahlung.
Hat die Einwilligung denn eine Auswirkung auf das arbeitsrechtliche Risiko?
Um es kurz zu machen -> nein, zumindest nicht direkt. Denn § 228 StGB regelt das Verhältnis zwischen Tätowierern und Kunden im Strafrecht. Die Kunden-Einwilligung bedeutet:
„Ich bin mir bewusst, dass ein Tattoo eine Körperverletzung ist.“
„Ich gebe Dir die schriftliche Erlaubnis diese Körperverletzung an mir vorzunehmen.“
Aber die Einwilligung enthält keinerlei arbeitsrechtliche Erklärung darüber, wer ein Risiko im Falle einer Komplikation trägt. Das Arbeitsrecht funktioniert davon komplett unabhängig.
Warum sehen wir das Urteil als problematisch aber reizvoll an?
Die Arbeitsgerichte werten den Tätowierer in ihren Urteilen als Beruf. Das ist er aber leider immer noch nicht!
Auch wenn professionelle Tattoo-Artists und zahlreiche ihrer Verbände sich schon seit Jahrzehnten selbst darum bemühen und sogar eigene Berufszugangs-Regulierungen und Ausbildungsinhalte dafür formuliert haben, so interessierte es die zuständigen Behörden und Ministerien bisher herzlich wenig.
Wenn der Staat es dabei aber versäumt, über eine Berufszugangs-Regelung Qualität zu sichern, und gleichzeitig Arbeitnehmer dafür bestraft, wenn sie bei einem solchen Dienstleister gesundheitliche Komplikationen erleiden, dann ist das ein Widerspruch im System.
Die schriftliche Einwilligung beim Tätowieren ist eine strafrechtliche Absicherung des Tattoo-Artists und nicht mehr und nicht weniger. Sie sagt nichts darüber aus, wie Krankheitsrisiken im Arbeitsverhältnis verteilt werden.
Das Gegenteil ist sogar der Fall. Wenn man das als Argument für den Verlust der Lohnfortzahlung heranzieht, dann müsste man folgerichtig auch bei jeder medizinisch nicht indizierten Körpermodifikation, jedem Piercing, jedem kosmetischen Eingriff und bei risikobehaftetem Freizeitsport die Lohnfortzahlung auch streichen. Das wäre arbeitsrechtlich und gesellschaftlich aber ein völliger Tabubruch.
Unsere kritischen Argumente gegen das Urteil:
Das Urteil erscheint uns weder zeitgemäß noch konsequent, weil es eine Dienstleistung unseres bunten Alltags als unzumutbares Privatrisiko klassifiziert, während andere private Tätigkeiten, die ebenso oder noch riskanter sind, nicht mit einem Ausschluss von der Lohnfortzahlung belegt sind.
Es wäre gut vertretbar zu fordern, dass man Tätowierungen und Permanent Make-up wie jede andere Ursache für Arbeitsunfähigkeit behandelt (alle vergleichbaren Risiken also auch gleichbehandelt werden).
I. Wo wird hierbei eigentlich genau die Grenze gezogen?
Wenn eine Tätowierung, wie vor den Arbeits-Gerichten als „eigenwirtschaftliches Risiko“ gilt, müsste doch Gleiches auch für kosmetische Eingriffe wie Botox, Filler, Permanent Make-up, Piercing, Haartransplantation, Schönheits-OP und Laser-Tattooentfernung gelten?!
Diese Eingriffe sind gesellschaftlich teils akzeptierter oder sogar beruflich zwingend notwendig. Aber wird hier gleichwertig geurteilt? Die Rechtslage dürfte man sich sicherlich mal genauer anschauen.
II. Wie steht es um die gesellschaftliche Akzeptanz von Tätowierung, zu denen auch das Permanent Make-up gehört?
Tätowierungen sind längst Teil des gesellschaftlichen Mainstreams und kein Extremphänomen mehr, wie es die Gerichte einordnen. Deutlicher wird es eventuell auch, wenn man hier mitbeachtet, dass ein gestochenes Permanent Make-up (PMU) ebenfalls eine Tätowierung darstellt.
Hätten die Gerichte eigentlich anders geurteilt, wenn es sich um eine explodierte Augenbraue oder Lippe gehandelt hätte?? Wie war das nochmal mit den mangelhaften Brustimplantaten damals?
Das Tattoo oder PMU sind heute also nicht mehr per se ein „risikobehaftetes Abenteuer“, sondern ein Dienstleistungsprodukt mit professionellen Standards und Hygienevorgaben. Lustig derweil, dass Kosmetiker(in) ein anerkannter Ausbildungs-Beruf ist, oder?!
Ist es nun ein Berufsrisiko oder doch ein Privatvergnügen? Die moderne Normalität von Tattoos und auch PMU könnten wohl getrost eine Neubewertung vertragen.
DAS sehen wir hier als „problematisch aber reizvoll“ für die Tätowierer an und ihre Bemühungen ein eigenes Berufsfeld zu schaffen.
III. Ungleichbehandlung gegenüber anderen Gesundheitsrisiken
Arbeitnehmer, die sich beim Skifahren, Fußballspielen oder Mountainbiken verletzen, erhalten selbstverständlich Entgeltfortzahlung. Obwohl diese Aktivitäten freiwillig und risikobehaftet sind.
Warum gilt das für das Tätowieren anders? Das erscheint widersprüchlich und aus unserer Sicht juristisch angreifbar.
IV. Pflicht zur Risikominderung
Tätowierer unterliegen zwar keiner Berufsregulierung aber strengen Hygienevorschriften und arbeiten mit EU-weit regulierten Tätowierfarben nach REACH. Werden diese eingehalten, ist das Risiko einer Tattoo-Komplikation vergleichsweise gering.
Ebenso wie bei Lebensmitteln oder ästhetisch-kosmetischen Behandlungen gibt es Restrisiken, die gesellschaftlich und dann auch von Gerichten akzeptiert sind.
Das Urteil der („Achtung!“) Arbeitsgerichte ignoriert, dass der Staat selbst das Tätowieren reguliert bzw. besser regulieren könnte/ müsste und hierbei als grundsätzlich legitime Dienstleistung anerkennt.
V. Übergriffigkeit in unser aller Privatsphäre
Dieses Urteil könnte den Eindruck erwecken, dass der Staat bzw. der Arbeitgeber bewertet, was ein „vertretbares“ privates Risiko für uns alle ist.
Das öffnet Tür und Tor für Diskussionen über diverse Lebensstile. Was ist mit Marathonläufen, Extremsport, Fernreisen und medizinisch nicht notwendigen Körpermodifikationen bis hin zur Diät?
Die Gefahr, die wir hierbei sehen, ist, einen Präzedenzfall zu schaffen, der zu einer problematischen Moralisierung von Krankheitsursachen führen kann.
Überspitzt, um es deutlicher zu machen: „Du kannst heute nicht zur Arbeit kommen, weil Du so schwach bist und dolle Kopfschmerzen hast, weil Du Diät machst? Ja, sorry! Dann auch keinen Lohn!„
6. Und was ist eigentlich mit dem Gleichheitsgrundsatz (Art. 3 GG)
Der Artikel 3 im Grundgesetz ist ja aktuell an vielerlei Stellen ein heißes Eisen. Die Ungleichbehandlung zwischen Tätowierten und z. B. Sportverletzten könnte derweil gegen den Gleichheitsgrundsatz verstoßen.
Es stellt sich für uns somit auch die Frage, ob das Urteil einer verfassungs-rechtlichen Prüfung standhielte. Nur weil man sich Bunt-mit-Benefits hat machen lassen und nicht mit dem Mountainbike die Böschung runtergeknallt ist, bekommt man keine Lohnfortzahlung mehr? Echt jetzt?? Beides übrigens sicherlich nicht mit Absicht!
Weiß eigentlich irgendjemand, was die Tattoo-Entzündung bei der Klägerin genau ausgelöst hat? Und wie wäre wohl von den Gerichten entschieden worden, wenn die Klägerin sich ihre Tätowierung nicht hätte stechen, sondern lasern lassen? Und wenn es ein PMU gewesen wäre?
Mon Dieu! Man muss wohl das allgemeine Lebensrisiko noch mal neu denken!

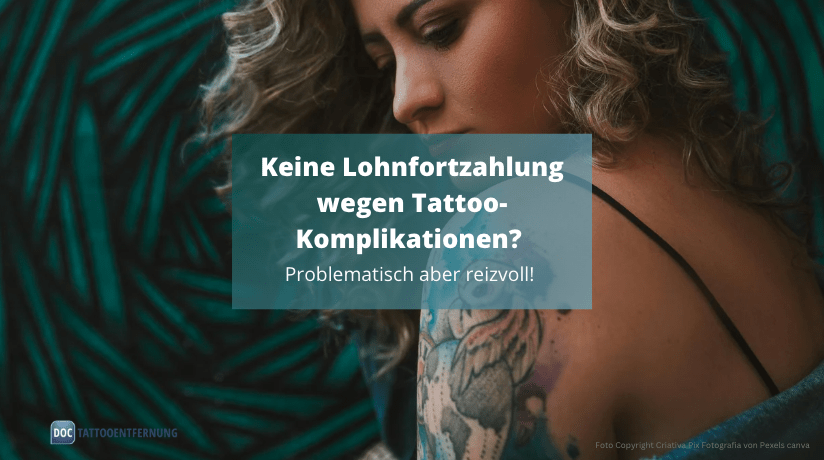
Warum hat sie ihrem Arbeitgeber überhaupt gesagt, warum sie krankgeschireben wurde? Auf dem Gelben ist das doch kodiert und geht keinen was an.
Coole Frage, Pascal. Wir haben keine Ahnung!
Entweder hat sie den „Gelben“ selber überreicht und da käme unweigerlich die Frage auf, warum ihr Arm eventuell verbunden war? Oder es wäre früher oder später eh rausgekommen, da der frisch tätowierte Arm bei einer Tätigkeit, die ohne Arme schlecht funktioniert, sichtbar geworden wäre.
Viele Grüße
Vielen Dank für den umfassenden Beitrag. Je längre man drüber nachdenkt desto schräger wird die ganze Sache für mich. Geben die Gerichte tatsächlich der Tattookundin die Schuld dafür das sich ihre Tättowierung entzündet hat? Wie kommen die denn überhaupt drauf? Oder verbinden die das damit das die Kundin ja zum Tätowierer gegangen ist und automatisch damit rechnen sollte das sich ihr Tattoo entzündet?
Hallo liebe Leonie,
herzlichen Dank fürs lesen und Deinen Kommentar.
Leider kennen wir die Prozessakte nicht, da sie noch nicht im Volltext vorliegt. Beim C.H. Beck Verlag kann man aber mal genauer nachlesen.
https://rsw.beck.de/aktuell/daily/meldung/detail/lag-schleswig-holstein-5sa284a24-taetowierungen-arbeitnehmer-arbeitsunfaehig-entgeltfortzahlung
Tatsächlich scheint es so – wie Du schon richtiger Weise nachgefragst -, dass beide Gerichte der Kundin die Schuld zu sprechen, dass sich ihre Tätowierung entzündet hat, und noch besser, dass sie damit hätte von Anfang an rechnen müssen.
Wir würden dazu herzlich gerne mal die Krankenakte und ärztliche Diagnose lesen und welche Herleitung hier stattgefunden hat, aus welchem Grund die Entzündungsreaktion entstanden ist.
Der Blumenstrauß an Möglichkeiten und Quellen ist nämlich riesig. Von mangelhafter Wundversorgung, unsterilem Tattoo-Werkzeug bis hin zu kontaminierten Tätowierfarben oder gar Pflegeprodukten für die Nachsorge.
Es reicht aber auch ein kleiner Krümel oder Tierhaar, um eine Entzündungsreaktion auszulösen. Das wissen wir aber alles nicht. Wir wissen nur, dass es wohl keine Infektion war.
Ein bisschen einlenken möchten wir bei der ganzen Thematik aber auch, da wir uns bei unseren Gedanken darum natürlich auch auf die Position der Arbeitgeberin stellen.
Sich als „Pflege“hilfskraft (hat grundsätzlich immer viel mit Hygiene zu tun) einem gewissen Risiko und vor allen Dingen einer zu heilenden mechanischen Haut-Verletzung aufgrund einer Tätowierung am „Unterarm“ während einer Arbeitsperiode (außerhalb von Urlaub als Bsp.) auszusetzen, könnte man mal überdenken, um es vorsichtig auszudrücken.
Es zauberte uns dann aber im weiteren Gedankengang auch ein Schmunzeln ins Gesicht – was wäre, wenn die Kundin/ Klägerin sich bei der Arbeit die Tattoo-Entzündung zugezogen hat?
Alles Spekulation aber wir erwähnen es mal, weil es unglaublich viele Herleitungen für solch eine Komplikation gibt.
Dass die Arbeitgeberin hier keine Lust hat Lohn für zu opfern, kann man aus ihrer Sicht sicherlich nachvollziehen. Aber da werden u.M.n. eventuell noch ganz andere „verstärkende“ Argumente für sie mit eingeflossen sein, um für sowas vor die Richterbank zu ziehen.
Viele Grüße
Es hat aber auch schon ganz andere Fälle solcher Form gegeben.
Wir erinnern hier mal vorsichtig an den Eintracht Frankfurt Spieler, der sich wenige Tage vor dem DFB-Finale hat tätowieren lassen und sich ebenfalls eine Entzündung einfing.
https://www.sueddeutsche.de/sport/fussball-eintracht-wirft-varela-wegen-tattoo-raus-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-170524-99-583233
Spaß kostet – IMMER!
Ohwee danke euch für die ausführliche Antwort. Jetzt wird mir die ganze Sache auch etwas klarer. Es ist wohl ziemlich schwer rauszukriegen wer an der Entzündung Schuld hat. Dann macht die Bestrafung der Kundin für mich ja noch wenoger Sinn.